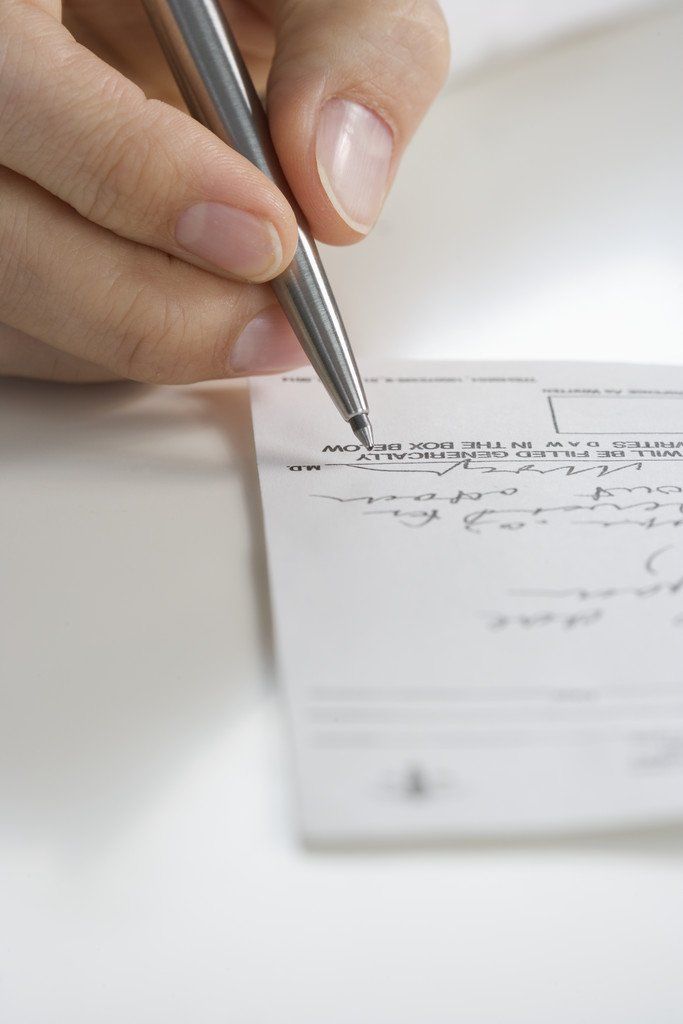Käuferrechte nach dem Tierkauf
Wie alle Lebewesen sind Tiere nicht immer topfit und gesund. Was tun, wenn also ein frisch erworbenes Tier plötzlich erkrankt?
Vernünftigerweise – insbesondere wenn ein Notfall gegeben ist – ist der erste Gang der zum Tierarzt, damit dem Tier schnell geholfen werden kann. Die dort entstehenden Kosten sind manchmal recht hoch. Dann stellt man sich oft die Frage, ob man diese Kosten nicht abwälzen kann.
Zunächst einmal sollte man wissen, dass Tiere, nach wie vor gemäß § 90a BGB durch Gesetze und Gerichte wie Sachen behandelt werden, sodass Tiere verkauft, verschenkt, vermietet, verliehen usw. werden können.
Jede Art der Überlassung von Tieren unter Aufgabe des Eigentums des bisherigen Eigentümers gegen Zahlung eines Entgeltes ist ein Kauf. Auch wenn oftmals die Verträge als Überlassungs-, Abgabe- oder Weitergabevertrag bezeichnet werden und die Bezeichnung der Gegenleistung als Gebühr, Schutzgebühr oder Entgelt usw. ändert dies hieran nichts. Somit finden die Regeln der §§ 433 ff. BGB Anwendung.
Erkrankt nun ein Tier nach dem Erwerb, hat der Käufer gegen den Verkäufer einen Anspruch auf Nacherfüllung (kostenfreie Lieferung einer mangelfreien Ersatzsache oder Mangelbeseitigung), Rücktritt vom Vertrag, Minderung des Kaufpreises oder auf Schadenersatz bzw. Ersatz vergeblicher Aufwendungen. Diese Ansprüche bestehen für die Dauer von 2 Jahren ab Kauf des Tieres. Erforderlich ist aber, dass der Mangel bei Übergabe des Tieres bereits vorhanden war. Der Mangel muss zu diesem Zeitpunkt noch nicht erkennbar sein, was bei Tieren häufig der Fall ist, wenn sie zwar Krankheitserreger bereits in sich tragen, die Krankheit aber noch nicht ausgebrochen ist. D.h., ob der Verkäufer für eine spätere Krankheit des Tieres haftet oder nicht, hängt vom jeweiligen Einzelfall ab. Bei Infektionskrankheiten wird man gewöhnlich von relativ kurzen Zeiträumen bis zum Ausbruch der Krankheit auszugehen haben. Bei anderen Krankheiten oder Verletzungen kann es sein, dass man von einer eher längeren Dauer bis zum Ausbruch oder bis zum Erkennen auszugehen hat.
Je nach dem, welche Ansprüche der Käufer geltend machen will, kommen weitere Voraussetzungen hinzu. So ist für einen Schadensersatz immer ein Verschulden des Verkäufers erforderlich. Dieses scheidet bei angeborenen unentdeckten Krankheiten meist aus.
Ist das Tier akut erkrankt, ist eine Aufforderung an den Verkäufer, den Mangel auf seine Kosten zu beseitigen, oftmals nicht zumutbar, denn hierdurch verstreicht zu viel Zeit, so dass das Tier unnötig leidet oder sich die Krankheit verschlimmert. Hier ist es ratsam, mit dem Tier selbst zum Tierarzt zu gehen, die Erstversorgung durchzuführen und von dem Verkäufer die Kosten zu verlangen (BGH, Urteil vom 22.06.2005, VIII ZR 1/05).
Vielfach wird der Verkäufer dem Käufer entgegen halten, dass die Parteien im Vertrag vereinbart haben, dass Mängelansprüche nach Übergabe des Tieres nicht mehr geltend gemacht werden können. Obgleich derartige Vereinbarungen grundsätzlich zulässig sind, ist sie dennoch sehr differenziert zu betrachten.
Ist der Kaufvertrag zwischen zwei natürlichen Personen abgeschlossen, ist zunächst davon auszugehen, dass es sich um einen Vertrag zwischen zwei Verbrauchern i.S. von § 13 BGB handelt. Hier ist der Ausschluss von Mängelansprüchen prinzipiell zulässig, es sei denn der Verkäufer kannte den Mangel und hat ihn dem Käufer gegenüber arglistig verschwiegen.
Anders sieht die Situation aus, wenn der Vertrag auf einem, wenn auch selbst gestalteten Formular mit in jedem Exemplar immer wiederkehrenden Klauseln abgeschlossen wurde, egal ob die betreffenden Felder mit Handschrift oder mit der Schreibmaschine oder im Computer ausgefüllt worden sind. Hierbei handelt es sich bereits um die Verwendung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Ist Vertragsgegenstand ein „neues“ Tier, dann ist der Ausschluss von Mängelansprüchen in AGB unzulässig (§ 309 Ziff. 8 b BGB). Wann ein Tier als „neu“ anzusehen ist, ist in der Rechtsprechung noch nicht abschließend geklärt.
Eine Verneinung des Haftungsausschlusses kommt auch dann in Betracht, wenn ein Tier von einem Züchter gekauft wurde und dieser den Haftungsausschluss in seinen Allgemeinen Geschäftsbedingungen eingefügt hat. Ein Züchter kann als Unternehmer i.S. von § 14 BGB anzusehen sein. Unternehmer ist, wer bei Abschluss des Rechtsgeschäftes in Ausübung seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. Als Unternehmer gilt jede Person oder Gesellschaft, die am Markt planmäßig und dauerhaft gegen Entgelt Leistungen anbietet. Geschäftliche Erfahrungen sind nicht erforderlich (so BGH, Beschluss vom 24.2.2005 - III ZB 36/04, BGH Urteil vom 4.5.1994 - XII ZR 24/93, OLG Rostock OLGR 2003, 505). Von einer Planmäßigkeit des Anbietens wird bereits dann auszugehen sein, wenn es nicht nur um Gelegenheitsverkäufe, geht. D.h. derjenige der immer wieder oder einmal mehrere Tiere anbietet, unterfällt schnell der Unternehmereigenschaft. Auch eine nebenberufliche Tätigkeit führt zur Unternehmereigenschaft.
Die vorstehenden, hochtrabend klingenden Erläuterungen sind erforderlich, um die Folgen verständlich zu machen. Sind nämlich die Partner eines Kaufvertrages auf Verkäuferseite ein Unternehmer und auf Käuferseite ein Verbraucher, dann ist der Ausschluss von Mängelansprüchen ausgeschlossen. Beim Verbrauchsgüterkauf hat der Verbraucher einen weiteren, sich aus § 476 BGB (neu § 477 BGB) ergebenden Vorteil. Tritt nämlich der Mangel in den ersten 6 Monaten nach Kauf des Tieres ein, muss nicht er das Vorhandensein des Mangels zum Zeitpunkt des Kaufes, sondern der Verkäufer beweisen, dass der Mangel zum Zeitpunkt des Kaufes nicht vorhanden war, sofern der Mangel nach seiner oder der Art der Sache, also des Tieres, vereinbar ist. Wann dies der Fall ist, ist – Sie ahnen es bereits – noch umstritten und nicht in allen Einzelheiten geklärt.
Beim Verbrauchsgüterkauf spielt es auch keine Rolle, ob es sich bei dem Tier um ein „neues“ oder um ein „gebrauchtes“ Tier handelt, es sei denn, es wurde auf einer Auktion erworben.
An dieser Stelle tut sich die Problematik auf, wie beim Kauf eines Tieres von einem Tierschutzverein zu verfahren ist? Derartige Vereine sind zwar in der Regel gemeinnützig, doch sind sie deshalb keine Unternehmer? Gemeinnützigkeit bedeutet, dass der Verein keine auf Gewinn gerichtete wirtschaftliche Tätigkeit entfalten darf. Eine Gewinnerzielungsabsicht ist aber wie gesagt für die Unternehmereigenschaft überhaupt nicht erforderlich. Es genügt das regelmäßige Anbieten von Leistungen gegen Entgelt am Markt. Die in den von den Tierschutzvereinen verwendeten Verträgen bezeichnete Schutzgebühr ist eine wohlwollende Umschreibung des Entgeltes, also des Kaufpreises. Damit dürfen Tierschutzvereine als Unternehmer zu behandeln sein, mit der Folge, dass Mängelausschlussklauseln in den als AGB einzustufenden Tierabgabeverträgen unwirksam sind.
Eine Rechtsschutzversicherung kann die nicht unerheblichen Prozessrisiken, die durch die Notwendigkeit von Gutachten ggf. verschärft werden, abfedern. Denn auch der Prozessgewinner kann auf beträchtlichen Kosten sitzen bleiben, wenn der Schuldner nicht liquide ist.
Hinweis: Sie dürfen diesen Artikel ohne Veränderungen zum Privatgebrauch oder zum internen Gebrauch unter Nennung dieses Hinweises und der Adressangaben gerne frei kopieren und weitergeben. Für die kommerzielle Nutzung ist das vorherige Einverständnis des Autors einzuholen. Bitte übersenden Sie ein Belegexemplar oder den direkten Link.
Fragen zu diesem Beitrag beantwortet der Verfasser nur im Rahmen eines Mandates oder in sonst berufsrechtlich zulässiger Weise.
Frank Richter
Rechtsanwalt
Kastanienweg 75a
69221 Dossenheim
Telefonnummer 06221/727-4619
Faxnummer 06221/727-6510